Bild: Hedgerow Village (,,Heckensiedlung“), Gruppe Archigram (Peter Cook, 1971)
Jarolim Antal hat im Rahmen seines Master of Advanced Studies in Real Estate an der Universität Zürich eine umfassende Untersuchung zur Bewilligungspraxis von mobilen Kleinwohnformen in der Schweiz als Abschlussarbeit durchgeführt. Wir haben die wichtigsten Informationen zusammengefasst und stellen die vollständige Arbeit gerne zur Verfügung.
Ausgangslage & Zielsetzung
In der Schweiz kann im öffentlichen Diskurs seit Jahren wachsendes Interesse an alternativen Wohnformen wie z.B. Tiny Houses beobachtet werden. Dennoch sind mobile Kleinwohnformen immer noch ein Nischenprodukt und werden nicht als Teil der Bau- oder Immobilienbranche betrachtet. Problematisch ist dabei nicht der Bau an sich, sondern vor allem die Standortsuche, da die Besitzer oft kein eigenes Land besitzen und es in der Schweiz für mobile Kleinwohnformen keine einheitliche Bewilligungspraxis oder Regulierung gibt. Die baurechtlichen Grundlagen scheinen für viele auf den ersten Blick unklar, was weder für die Marktentwicklung noch für die Akzeptanz dieser immer noch alternativen Wohnformen förderlich sei.
Ziel dieser Arbeit war, die Bewilligungspraxis von mobilen Kleinwohnformen in der Schweiz zu untersuchen und die grössten Schwierigkeiten und Probleme im Baubewilligungsprozess sowie deren Ursachen und mögliche Lösungen zu erörtern. Es wurden Fragen nach den Gründen für die als unklarer Graubereich wahrgenommene Bewilligungspraxis gestellt und mögliche Handlungsoptionen zur Schaffung von Klarheit als Denkanstösse aufgezeigt. Zudem wurde das Potenzial der mobilen Kleinwohnformen anhand der geltenden Baugesetzgebung und den Gegebenheiten in der Schweiz untersucht.
Inhalt der Arbeit
Die Arbeit untersucht die theoretischen Grundlagen, präsentiert einen umfassenden Überblick über die Problematik und analysiert die aktuellen Herausforderungen sowie potenzielle Lösungsansätze.
Zusammenfassung Erkenntnisse
Der Begriff „mobile Kleinwohnform“ scheint den Behörden zwar bekannt zu sein, jedoch konnten bisher nur wenige Erfahrungen mit mobilen Kleinwohnformen gesammelt werden, da diese in der Schweiz wenig verbreitet sind.
Betreffend Bewilligungspraxis herrscht keine einheitliche Meinung darüber, wie und ob überhaupt die Verfahren für mobile Kleinwohnformen vereinfacht werden sollten oder könnten. Die Einführung einer neuen Zone speziell für mobile Kleinwohnformen scheint nicht notwendig, da eine Baubewilligung in einer Wohnzone heute möglich ist. Die grössten Schwierigkeiten bereiten den involvierten Akteuren die Auslegung der Gesetzgebung sowie die fehlende Unterscheidung zu konventionellen Wohnbauten v.a. in der Energiethematik.
Die mobilen Kleinwohnformen weisen Potentiale auf. Zu ihren Stärken gehören Einfachheit, Kompaktheit und eine gewisse Flexibilität, nicht an einen Ort gebunden zu sein. Auf vielen Ebenen sind sie ressourcenschonend und bieten im kleinen Rahmen eine einfach skalierbare Alternative zum konventionellen Wohnangebot. Sie sind in der Schweiz als flexible Möglichkeit zur Nachverdichtung bestehender Strukturen und Gebiete denkbar, wobei es bei der Umsetzung auch Herausforderungen gibt.
Vollständige Arbeit
Wir finden die Arbeit sehr gelungen und freuen uns, dass Jarolim sich dazu entschieden hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wir möchten uns auch herzlich dafür bedanken, dass wir die gesamte Arbeit hier veröffentlichen dürfen für Interessierte.
Mobile Immobilie: Eine Untersuchung der Bewilligungspraxis von mobilen Kleinwohnformen in der Schweiz anhand eines Vergleichs zwischen den Kantonen Zürich und Graubünden.





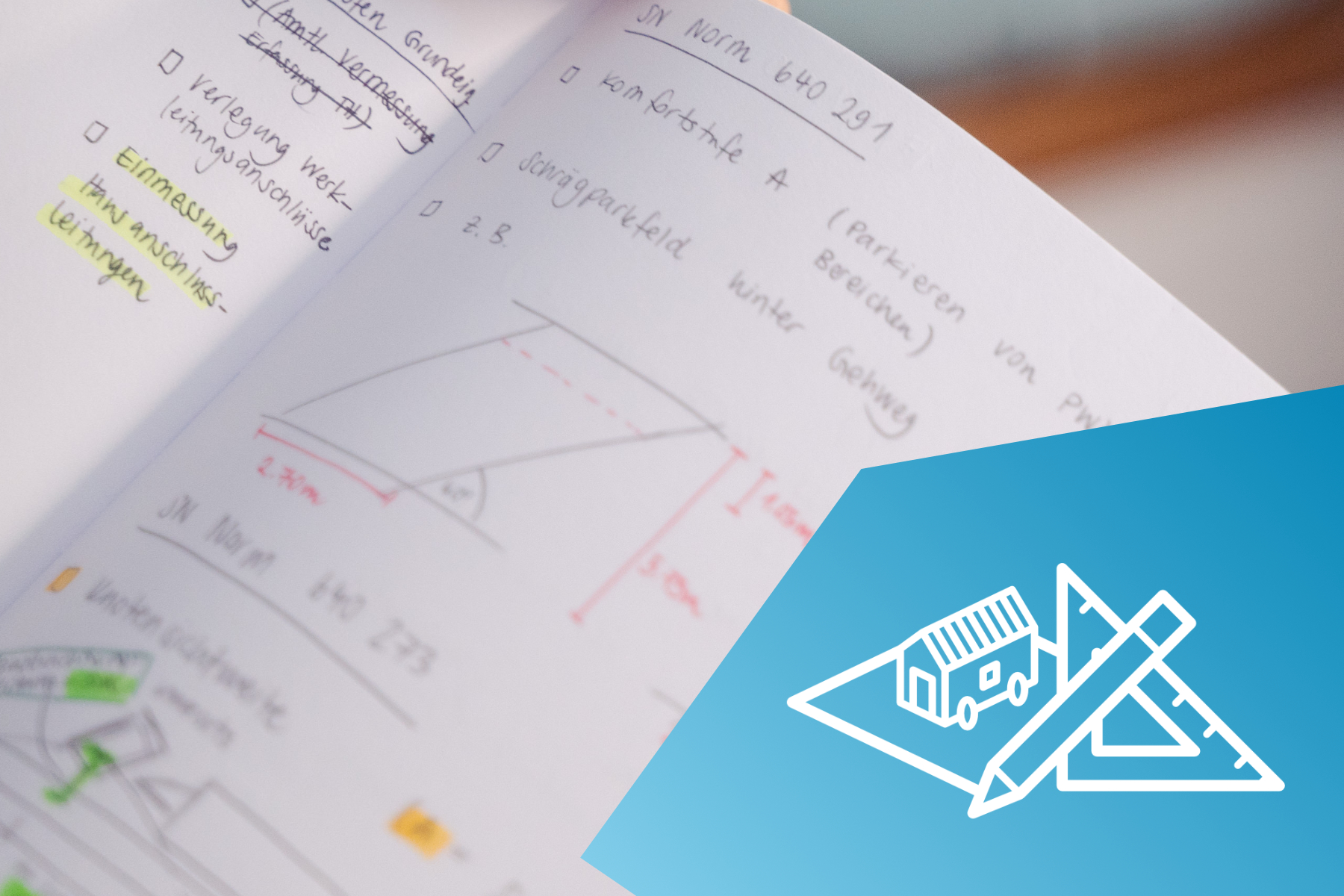
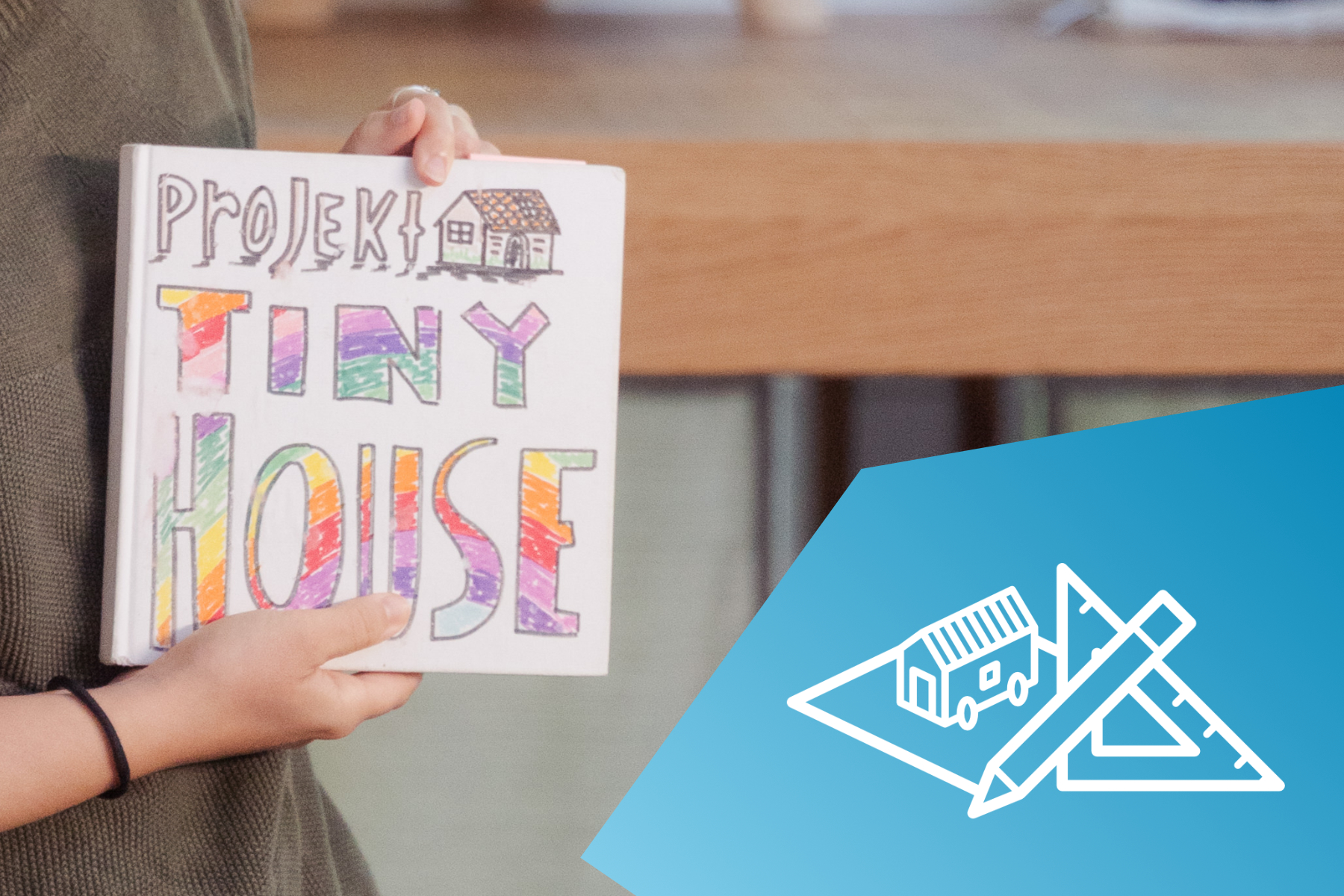



Hinterlasse einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.